Wochenblatt, Odessa 1917
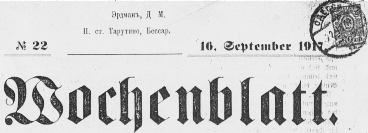
Zeitgenössischer Artikel aus dem "Wochenblatt", in dem der Autor zu Spenden für die ausgesiedelten Wolhyniendeutschen aufruft und um Verständnis für ihre schwierige Situation wirbt. Das "Wochenblatt" (Jeshenedelnik) war das Organ des Allrussischen Verbands der Russischen Deutschen und wurde ab Mitte April 1917 in Odessa veröffentlicht.
![]() Es ist allgemein bekannt, daß zu seiner Zeit die Deutschen Wolhyniens, sowie auch des Königreichs Polen und eines Teils der Ostseeprovinzen in das Innere Rußlands ausgesiedelt worden sind. - Da aber die deutsche Presse beim alten Regime verboten war, so sind die Verhältnisse dieser Unglücklichen, in denen sie sich befanden und noch befinden, fast gar nicht bekannt geworden. Und wenn man auch hie und da einen solchen Unglücklichen darüber befragte, so schenkte man oft seiner Schilderung nicht völligen Glauben, in der Meinung, es möge manches übertrieben sein, da doch nichts davon in der russischen Presse berichtet worden war und solche Ungerechtigkeit doch unmöglich geschehen könnte. In vielen Fällen wollte man durchaus zweifeln an der Willkür gegen die Deutschen, in der Meinung, die Aussiedlung sei der Front halber geschehen. - Ja man kam noch weiter: wenn solch ein Verbannter, moralisch und physisch geschlagen durch erlittene Schmach, sich nicht gleich knechtisch an Ort und Stelle untergeben und mit den moralisch wie physisch Gesunden tapfer mitarbeiten wollte, so fand es sich häufig, daß man diese Unglücklichen der Unglücklichsten allgemein der Faulheit beschuldigte.
Es ist allgemein bekannt, daß zu seiner Zeit die Deutschen Wolhyniens, sowie auch des Königreichs Polen und eines Teils der Ostseeprovinzen in das Innere Rußlands ausgesiedelt worden sind. - Da aber die deutsche Presse beim alten Regime verboten war, so sind die Verhältnisse dieser Unglücklichen, in denen sie sich befanden und noch befinden, fast gar nicht bekannt geworden. Und wenn man auch hie und da einen solchen Unglücklichen darüber befragte, so schenkte man oft seiner Schilderung nicht völligen Glauben, in der Meinung, es möge manches übertrieben sein, da doch nichts davon in der russischen Presse berichtet worden war und solche Ungerechtigkeit doch unmöglich geschehen könnte. In vielen Fällen wollte man durchaus zweifeln an der Willkür gegen die Deutschen, in der Meinung, die Aussiedlung sei der Front halber geschehen. - Ja man kam noch weiter: wenn solch ein Verbannter, moralisch und physisch geschlagen durch erlittene Schmach, sich nicht gleich knechtisch an Ort und Stelle untergeben und mit den moralisch wie physisch Gesunden tapfer mitarbeiten wollte, so fand es sich häufig, daß man diese Unglücklichen der Unglücklichsten allgemein der Faulheit beschuldigte.
Um fernerhin nicht ungerecht gegen diese Unglücklichen zu sein, so habe ich mir, da mir ihre Verhältnisse genau bekannt sind und da es durch die neue Regierung wieder möglich geworden ist, Deutsche Zeitungsorgane zu haben, es zur Aufgabe gemacht, ein möglichst klares Bild ihrer Erlebnisse, so wie auch ihre gegenwärtige Lage darzustellen.
Es ist ja bekannt, daß der Feind im 1914 Jahre in Polen eindrang. Infolgedessen wurden die Deutschen Polens im August und September desselben Jahres ausgesiedelt, hatten aber die Freiheit, den Zufluchtsort sich selbst wählen zu dürfen.
Da die Wolhynier fast alle aus Polen herstammten, so flüchteten die meisten, selbstverständlich, nach Wolhynien. Hier wurden sie als unglückliche Gäste aufgenommen und als solche behandelt. Es war fast kein Haus, welches nicht einen oder mehrere Unglückliche barg. So wurden die unglücklichen Gäste in eigener Wohnung, auch meistenteils bei eigener Tafel bis zum Frühling unterhalten.
Als dann die Frühlingsarbeit herannahte, so meinten die Wolhynier, daß sie aber auch zum Dank für die erwiesene Wohltat recht fleißige und billige Tagelöhner und Dienstleute zu erwarten berechtigt seien. Aber, o weh, sie hatten sich geirrt, denn wenn auch solch ein unglücklicher Gast wohl 3-4 Tage als Tagelöhner erschien, so blieb er schon in den meisten Fällen am fünften Tage zurück. Wenn man ihn dann fragte, warum er nicht erscheine zur Arbeit, so gab ein solch unglücklicher Gast, oft mir bebender Stimme, zur Antwort: "Ich kann nicht: es fällt mir alles aus den Händen. Das Heimweh und das Unglück haben mich meiner Kräfte beraubt."
Geneigter Leser, es ist erschütternd, solche Ausdrücke mit eigenen Ohren hören zu müssen. Und doch muß ich Dir sagen, daß es mitunter auch bei den Wolhyniern solche gab, die unter der Faust sagten: "Die 'Poler' sind faul, die wollen nicht arbeiten."
"Aha, so ist's, was der Mensch sät, muß er ernten. Ihr habt die 'Poler' der Faulheit beschuldigt, und wir euch!" wirst Du lieber Leser wohl denken. - Aber, hast Du auch schon daran gedacht, wer Dich in denselben Verhältnissen solcher Faulheit beschuldigen kann? Und meine nur nicht, Dir kann und wird so etwas nicht widerfahren! Die Wolhynier meinten auch so, und doch mußten und müssen sie es noch sehen und fühlen, wie andere Völker in ihren, noch weit von der Front entfernten Wirtschaften hausten und noch hausen, während sie im Elend verderben müssen, und dies zwar schon durch "zwei lange bittere Jahre".
"Ja, wohin würde man uns denn aussiedeln, es ist doch kein Raum vorhanden?" fragte man oft. Ach, man würde schon ein Räumlein irgendwo, sei es in einem Stallwinkel, oder in einer alten abgedeckten Küche finden, wie man es ja zum Teil an jenen schon getan hat, und noch zu tun gedenkt.
Ja, welches ist denn die richtige Ursache, durch welche sich diese Leute so entkräftet fühlen? Diese Frage läßt sich schriftlich nur schlecht beantworten. Man kann nur dann ein richtiges Verständnis davon haben, wenn man sich eben in gleichen Verhältnissen mit diesen Unglücklichen befindet. Doch will ich mich bemühen, einigermaßen ihre Erlebnisse zu schildern, um dadurch nach Möglichkeit die Ursache zu deuten.
 Am 14. Juni 1915 kam der Befehl an alle Einwohner, bis zum 7. Juli die Häuser zu räumen, und sich auf die Flucht zu begeben; denn der Feind schien vorzudringen. Am 6. Juli abends kam die frohe Botschaft: "Der Feind ist geschlagen, weiter kann er nicht mehr vordringen in Wolhynien. Zwei Monate lang kann man jetzt ruhig wohnen." Am 7. Juli kam der Befehl, von Eilboten ausgeschrien, welcher lautete: "Am 10. Juli darf keine deutsche Seele in deutschen Wirtschaften mehr vorgefunden werden." - Alles bereitete sich zum Aufbruch. Vom Inventar verkaufte man sehr wenig, wobei die Nerven der Deutschen übel zugerichtet wurden, da man die Gegenstände unter großem Drängen für den acht- bis zwölffach verringerten Preis veräußern mußte. Am 10. Juli kam die Botschaft, daß alle Deutschen noch wohnen bleiben können bis zum 20. Juli. Alle dankten Gott, denn die Ernte war reif und man machte sich schnell zur Ernte, um dadurch sich etliche Rubel für die Zukunft zu retten. Am 1. Juli (?), da schon manche Scheuer mit Getreide gefüllt war, erging der Befehl: "Alle diejenigen, die aus ihrer Familie jemand im Kriege haben, wenn man mit Briefen von der Front es beweisen kann, können bleiben, alle anderen müssen weichen".
Am 14. Juni 1915 kam der Befehl an alle Einwohner, bis zum 7. Juli die Häuser zu räumen, und sich auf die Flucht zu begeben; denn der Feind schien vorzudringen. Am 6. Juli abends kam die frohe Botschaft: "Der Feind ist geschlagen, weiter kann er nicht mehr vordringen in Wolhynien. Zwei Monate lang kann man jetzt ruhig wohnen." Am 7. Juli kam der Befehl, von Eilboten ausgeschrien, welcher lautete: "Am 10. Juli darf keine deutsche Seele in deutschen Wirtschaften mehr vorgefunden werden." - Alles bereitete sich zum Aufbruch. Vom Inventar verkaufte man sehr wenig, wobei die Nerven der Deutschen übel zugerichtet wurden, da man die Gegenstände unter großem Drängen für den acht- bis zwölffach verringerten Preis veräußern mußte. Am 10. Juli kam die Botschaft, daß alle Deutschen noch wohnen bleiben können bis zum 20. Juli. Alle dankten Gott, denn die Ernte war reif und man machte sich schnell zur Ernte, um dadurch sich etliche Rubel für die Zukunft zu retten. Am 1. Juli (?), da schon manche Scheuer mit Getreide gefüllt war, erging der Befehl: "Alle diejenigen, die aus ihrer Familie jemand im Kriege haben, wenn man mit Briefen von der Front es beweisen kann, können bleiben, alle anderen müssen weichen".
Nun stand der ganze Ernst der Sache unbeweglich fest. Am nie vergeßlichen siebzehnten Juli fuhren unsere Wolhynier samt den gewesenen 'Polern' unter heißen Tränen, mit flehendem Gebet um Schutz und Erbarmen, von ihren Höfen.
Den Marterweg, zur Achse, von der Heimat bis Kiew und weiter, kann man nur auf vielen Seiten eines anständigen Buches schildern. Man suchte sich, auf alle erdenkliche Art und Weise, an diesen unschuldigen Opfern für die erlittenen Niederlagen an der Front zu rächen. Ja, oft hat man ihnen und den Pferden das Wasser verwehrt. - Es gab Momente, daß selbst ihre Quäler, die knechtischen Seelen des Zarismus, sich wegwandten und Tränen vergossen über das Elend, das sie zuwege bringen mußten. Ich bin fest überzeugt, daß die berühmtesten Dichter das nicht wiedergeben könnten, was auf diesem Marterwege geschah.
Sie wurden in die Zentralgouvernements und nach Sibirien gewiesen. Ihre Bitten, sie in den Süden lassen zu wollen, wurden kategorisch zurückgewiesen, daher sind hier ja auch nur ganz wenig vorhanden. Viele verloren ihren Verstand, viele starben vor erlittener Schmach. An vielen Frauen erfüllte sich buchstäblich das Wort des Heilandes: "Wehe den Schwangeren und Säuglingen zu derselben Zeit!"
Hieraus kannst Du nun, lieber Leser, einen kleinen Teil der Ursache der Mutlosigkeit dieser Unglücklichen kennen lernen. Aber es ist erst der kleinere Teil, der größere folgt noch. - An Ort und Stelle angekommen, wurden sie von den Landeskindern nur mißtrauisch und feindlich angeblickt, denn sie waren ja doch die Verbannten! ... Überall hieß es nur: "Die verfluchten Deutschen! Die Verräter unseres Vaterlandes!" - Die noch Nachgebliebenen wurden, unter fast denselben Umständen, am 15. Februar 1916 ausgesiedelt.
In diesen Verhältnissen mußten diese Unglücklichen schon zwei lange, bittere Jahre leben. Ihre Zahl, die bedeutend groß war, ist schon sehr gesunken, denn mancher Vater und manche Mutter sanken vor Gram oft kurz nacheinander ins Grab, und so blieben die heimat- und hilflosen Kinder ohne Schutz, ja, ganz alleine in der Fremde.
Viel trauriger aber noch scheint sich die Lage der meisten dieser Unglücklichen, die sich gegenwärtig in den Gouvernements Saratow und Samara befinden, im Lichte der Zukunft zu gestalten.
Wie bekannt, ist in diesen zwei Gouvernements völlige Mißernte. Der Briefwechsel, den ich mit diesen Unglücklichen immer rege unterhalte, bringt mir immer zahlreichere Schreckenskunden. Moralisch gebrochen durch den stets nagenden Wurm, und physisch übermüht, um ein Dasein zu fristen, streckt sich ein Familienvater nach dem anderen aufs Krankenlager und stirbt.
Es folgt ein Spendenaufruf. Der Autor schließt:
Lieber Leser, zürne mir nicht, daß ich so lange geschwiegen habe von dem Lobenswerten, was für diese Unglücklichen schon getan worden ist. Es sind zwar schon etliche tausend Rubel ihnen zugesandt worden, doch muß ich sagen: es ist nur ein Tropfen in ein Meer von Elend. Es müssen andere und größere Opfer gebracht werden. "Ja, was für Opfer sollen denn das sein", wirst du fragen. Zur Antwort auf diese Frage, möchte ich bitten nachzusinnen, was unsere Deutschen im Süden, sowohl wie auch in anderen Gegenden Rußlands getan, womit sie ihren Patriotismus im Anfang des Krieges bewiesen haben. Es wurden Tausende Pud von Mehl und Weizen, Hunderttausende Rubel Geld geopfert für den Krieg. Sogar hat man etliche Waggons geräuchertes Schinkenfleisch an die Front geschickt.
Darum, deutsches Herz, weniger Kritik an den armen Unglücklichen. Wärst du in ihrer Lage, du wärst kaum fleißiger und besser.
G. S.